Was passiert mit Ihrer Immobilie, wenn jemand stirbt?
Wenn ein Familienmitglied stirbt, geht nicht nur ein Mensch verloren - es beginnt auch ein komplexer rechtlicher und finanzieller Prozess. Eine der wichtigsten Fragen: Wie viel ist die Immobilie wert? Denn der Wert bestimmt, wie viel Erbschaftsteuer fällig wird. Und hier liegt das Problem: Das Finanzamt bewertet oft viel höher, als die Immobilie wirklich wert ist. Viele Erben zahlen deshalb unnötig Tausende Euro mehr an Steuern - nur weil sie kein unabhängiges Gutachten haben.
Der Stichtag: Der Tag, der alles entscheidet
Es gibt nur einen einzigen Tag, der für die Bewertung zählt: der Todestag des Erblassers. Das ist der sogenannte Stichtag. Alles, was danach passiert - ob Renovierung, Mieterhöhung oder Marktboom - zählt nicht für die Steuerberechnung. Selbst wenn die Immobilie zwei Wochen nach dem Tod für 20 % mehr verkauft wird, bleibt der Wert vom Todestag maßgeblich.
Das Finanzamt ignoriert das oft. Es schaut auf aktuelle Preise, nicht auf den Tag, an dem der Erblasser starb. Das ist falsch. Ein unabhängiger Sachverständiger hingegen arbeitet strikt nach diesem Prinzip. Und genau das macht den Unterschied.
Wie das Finanzamt bewertet - und warum es oft falsch liegt
Das Finanzamt nutzt fast immer den gleichen Trick: Es nimmt den Bodenrichtwert des Gutachterausschusses und multipliziert ihn mit einem festen Faktor. Bei Einfamilienhäusern ist das oft 1,2. Klingt simpel - ist aber falsch.
Der Bodenrichtwert wird nur alle 12 bis 24 Monate aktualisiert. In Städten wie Berlin, München oder Hamburg steigen die Preise aber jährlich um 5 % oder mehr. Das Finanzamt rechnet also mit alten Zahlen - und kommt zu einem viel zu niedrigen Bodenwert. Dann nimmt es einen pauschalen Faktor und rechnet nach oben. Ergebnis: Die Immobilie erscheint teurer, als sie ist.
Dazu kommt: Das Finanzamt ignoriert fast immer
- Sanierungsbedarf (Risse, Feuchtigkeit, alte Fenster)
- schlechte Lage (nahe Autobahn, Lärm, keine Parkplätze)
- veraltete Ausstattung (Küche, Badezimmer, Heizung)
- fehlende Energieeffizienz
Ein Gutachter hingegen prüft genau das. Er geht auf die Straße, schaut sich ähnliche Immobilien an, misst die Wohnfläche genau und bewertet den Zustand. Das Ergebnis? Oft 15 bis 25 % niedriger als die Bewertung des Finanzamts.
Drei Verfahren - nur eines wird oft richtig angewendet
Das Gesetz schreibt drei Verfahren vor, um Immobilien im Erbfall zu bewerten:
- Vergleichswertverfahren: Das ist das Standardverfahren. Es vergleicht die Immobilie mit ähnlichen, kürzlich verkauften Objekten in der Nachbarschaft. Mindestens drei Vergleichsobjekte müssen her. Das ist der einzige Weg, den tatsächlichen Marktwert zu finden.
- Ertragswertverfahren: Wird bei vermieteten Wohnungen oder Gewerbeimmobilien angewendet. Hier wird berechnet, wie viel Miete die Immobilie einbringt - abzüglich Instandhaltung, Verwaltungskosten und Leerstand.
- Sachwertverfahren: Hier wird der Wert der Bausubstanz berechnet, also die Kosten, die entstehen würden, das Haus neu zu bauen. Nur bei seltenen Fällen, etwa bei historischen Gebäuden, wird es verwendet.
Das Finanzamt greift fast immer zum Vergleichswertverfahren - aber falsch. Es nutzt nicht die tatsächlichen Verkaufspreise, sondern nur den Bodenrichtwert. Ein Sachverständiger hingegen sucht echte Verkaufsdaten aus dem Grundbuch oder von Maklern. Das macht den Unterschied.
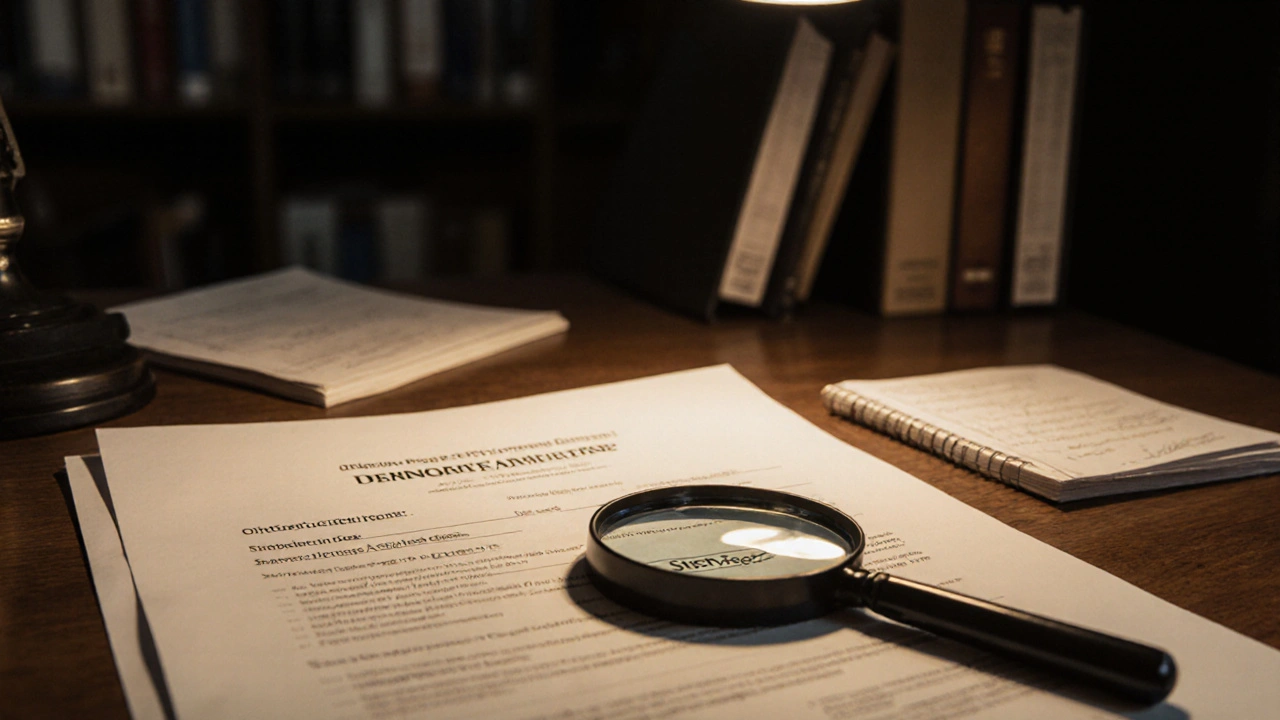
Warum ein unabhängiges Gutachten lohnt - und wie viel es kostet
Ein unabhängiges Gutachten von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (ÖbVI) kostet zwischen 800 und 2.500 Euro - je nach Größe und Lage der Immobilie. Klingt viel? Ist es aber nicht.
Stellen Sie sich vor: Ihr Haus wird vom Finanzamt auf 600.000 Euro bewertet. Sie zahlen Erbschaftsteuer auf diesen Wert. Ein Sachverständiger ermittelt aber nur 480.000 Euro - also 120.000 Euro weniger. Bei einem Steuersatz von 15 % sparen Sie 18.000 Euro. Das Gutachten hat sich also in 10 Tagen amortisiert.
Und das ist kein Einzelfall. Eine Studie der Bundessteuerberaterkammer aus 2023 zeigt: In 82 % der Fälle führt ein unabhängiges Gutachten zu einer niedrigeren Bewertung. Und das Finanzamt akzeptiert diese in 88 % der Fälle - ohne Streit. Denn es muss stichhaltige Gründe nennen, um abzuweichen. Und das kann es oft nicht.
Freibeträge: Was Sie steuerfrei erben dürfen
Bevor Sie überhaupt die Steuer berechnen, gibt es Freibeträge. Die sind enorm wichtig - und werden oft vergessen.
- Ehepartner oder Lebenspartner: 500.000 Euro
- Kinder: 400.000 Euro
- Enkelkinder: 200.000 Euro
- Geschwister: 20.000 Euro
- Neffen und Nichten: 20.000 Euro
Wenn Ihr Haus 450.000 Euro wert ist und Sie das Kind des Erblassers sind, zahlen Sie gar keine Steuer - denn 450.000 ist unter dem Freibetrag von 400.000? Nein - 450.000 ist über 400.000. Also 50.000 Euro werden besteuert. Aber: Wenn das Gutachten den Wert auf 380.000 Euro senkt, dann zahlen Sie gar nichts. Das ist kein theoretisches Szenario. Das passiert täglich.
Das Familienheim: Steuerfrei, wenn Sie es behalten
Wenn Sie das Haus des Verstorbenen selbst bewohnen - und es mindestens 10 Jahre lang behalten -, können Sie es steuerfrei erben. Das gilt nur, wenn
- Sie das Haus nach dem Tod direkt bewohnen
- Sie es nicht verkaufen
- Sie es mindestens 10 Jahre lang nutzen
Das ist eine der größten Steuereinsparungen, die es gibt. Aber: Das Finanzamt prüft das streng. Sie müssen nachweisen, dass Sie dort tatsächlich wohnen - mit Meldebescheinigung, Stromrechnung, Briefen. Ein Gutachten hilft hier nicht - aber es schützt Sie, wenn es um den Wert geht, den Sie vor der Freistellung angeben müssen.
Was das Finanzamt verlangt - und was Sie liefern müssen
Wenn das Finanzamt Ihre Steuererklärung prüft, braucht es Unterlagen:
- Grundbuchauszug
- Baujahr und Art der Bebauung
- Wohnfläche (nach DIN 277 gemessen)
- Mietverträge (bei vermieteten Wohnungen)
- Sanierungsbelege (wenn vor dem Tod erledigt)
Wenn Sie diese Unterlagen nicht haben, wird das Finanzamt einfach schätzen - und meist übertreiben. Ein Gutachter hingegen sammelt diese Unterlagen für Sie. Er misst die Fläche korrekt, prüft die Bauunterlagen und dokumentiert alles. Das ist Ihr Schutz.
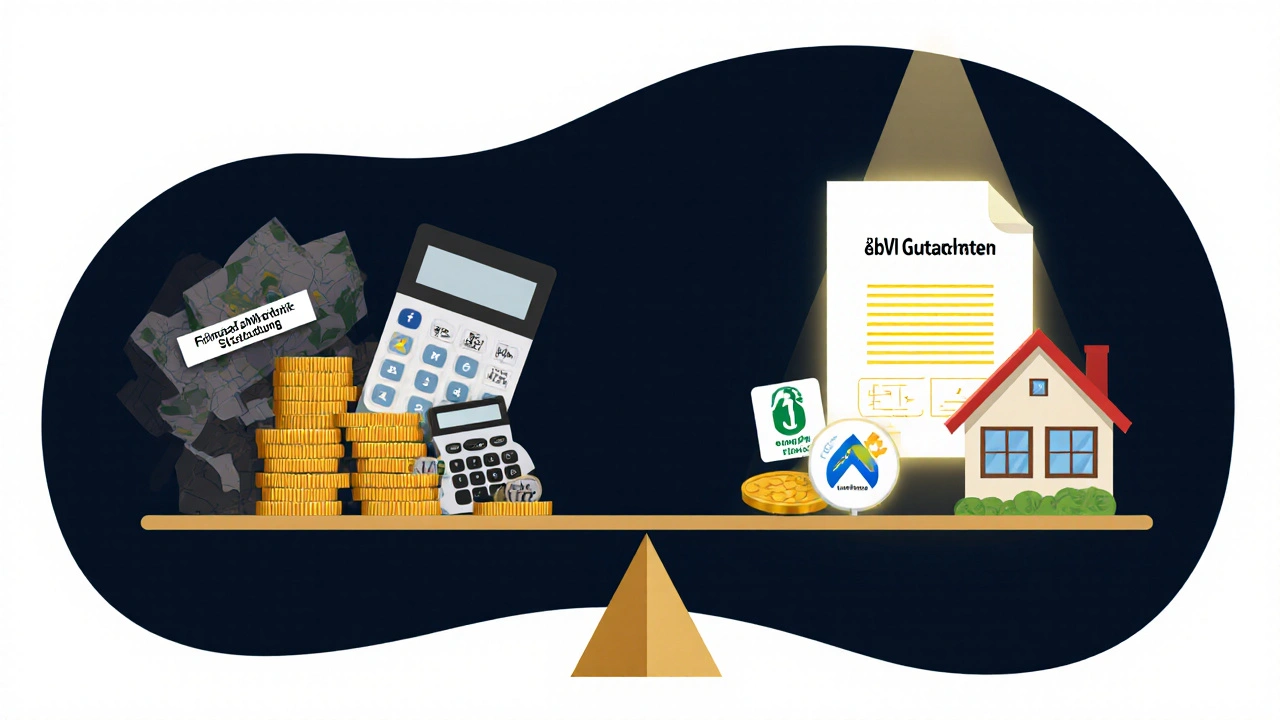
Sanierungsbedarf: Ein versteckter Wertverlust
Ein Haus mit alten Fenstern, einer kaputten Heizung und feuchten Wänden ist nicht weniger wert - es ist viel weniger wert. Aber das Finanzamt ignoriert das in 89 % der Fälle. Eine Studie der Deutschen Steuerberatervereinigung zeigt: Bei Immobilien mit Sanierungsbedarf wird der Wert durch das Finanzamt durchschnittlich um 22 % zu hoch angesetzt.
Das Bundesfinanzhof hat 2022 klargestellt: Sanierungsbedarf muss berücksichtigt werden. Und 2023 hat er nochmal entschieden: Auch energetische Sanierungen, die nach dem Tod vertraglich vereinbart waren, können in die Bewertung einfließen - wenn sie vorher festgelegt waren.
Ein Gutachter notiert genau: „Dach muss erneuert werden - Kosten ca. 35.000 Euro.“ „Fenster aus 1985, kein Wärmeschutz.“ „Heizung nicht mehr betriebsfähig.“ Diese Punkte senken den Wert - und damit die Steuer.
Streit unter Erben? Ein Gutachten verhindert ihn
43 % aller Erbschaften führen zu Streit zwischen den Erben. Warum? Weil keiner weiß, wie viel die Immobilie wirklich wert ist. Jeder glaubt, er bekommt weniger. Der eine sagt: „Die ist 700.000 Euro wert.“ Der andere: „Nein, nur 500.000.“
Ein unabhängiges Gutachten schafft Klarheit. Es ist neutral. Es ist fachlich fundiert. Es ist rechtlich bindend - wenn es von einem ÖbVI kommt. Dann kann kein Erbe mehr sagen: „Das ist doch nur Ihre Meinung.“
Was kommt als Nächstes? Digitale Bewertung ab 2025
Das Finanzamt will ab 2025 künstliche Intelligenz nutzen, um Immobilien automatisch zu bewerten. Klingt modern - ist aber riskant. Denn KI lernt aus Daten - und die Daten des Finanzamts sind oft falsch. Wenn die KI nur die falschen Bodenrichtwerte und pauschalen Faktoren kennt, wird sie weiterhin überbewerten.
Ein menschlicher Sachverständiger hingegen prüft den Zustand, die Lage, die Ausstattung - und denkt kritisch. Das kann eine Maschine nicht. Deshalb: Ein Gutachten bleibt wichtiger denn je.
Was Sie jetzt tun müssen
Wenn Sie eine Immobilie erben:
- Notieren Sie den Todestag - das ist Ihr Stichtag.
- Sammeln Sie alle Unterlagen: Grundbuchauszug, Baujahr, Mietverträge, Sanierungsbelege.
- Holen Sie ein unabhängiges Gutachten von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ein - bevor Sie die Steuererklärung abgeben.
- Reichen Sie das Gutachten zusammen mit der Erbschaftsteuererklärung ein.
- Warten Sie auf die Antwort des Finanzamts - in den meisten Fällen akzeptiert es das Gutachten.
Ein Gutachten ist keine Ausgabe - es ist eine Investition. In Ihrer finanziellen Freiheit. In Ihrem Frieden. Und in Ihrem Recht, nicht mehr zu zahlen, als Sie wirklich schulden.
